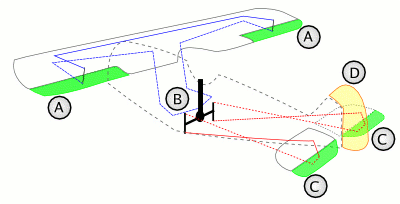8.5 Steuerung
- 8.5.1 Hauptsteueranlagen
- 8.5.2 Nebensteueranlagen
- 8.5.3 Vereisung
8.5.1 Hauptsteueranlagen
Die Steuerung (das Steuerwerk) dient der Übertragung. der Steuerbewegungen, die der Pilot an den Bedienelementen ausführt (Steuerknüppel, Pedale, Brems- und Wölbklappenhebel), auf die Steuerflächen (Ruder und Klappen). So bewirkt z.B. ein Ziehen des Steuerknüppels nach hinten, ein Anheben der Flugzeugnase und damit eine Vergrößerung des Anstellwinkels der Tragflächen.
- Rollen um die Längsachse mit den Querrudern (A)
- Nicken um die Querachse mit dem Höhenruder (C)
- Gieren um die Hochachse mit dem Seitenruder (D)
Ja, die o.g. Begriffe mögen widersprüchlich erscheinen, werden aber in deiner Prüfung bestimmt abgefragt. Also lese sie dir lieber gleich nochmal durch und versuch dir vorzustellen mit welchem Ruder du das Flugzeug um welche Achse bewegst!
Die Übertragung erfolgt entweder durch Stoßstangen und Umlenkhebel (Vorteil: hohe Steifigkeit, geringe Reibung) oder durch Drahtseile mit Seilführungen, Umlenkrollen, Spannschlössern (Vorteil: geringes Gewicht, wenig Raumbedarf)
|
Seitensteuer
|
Bremsklappen
|
Wölbklappen
|
Trimmung
|
Primäre- und Sekundäre Wirkung vom Seitenruderausschlag
Die primäre Wirkung des Seitenruders besteht darin, eine Gierbewegung um die Hochachse des Flugzeugs zu erzeugen. Wenn das Seitenruder ausgeschlagen wird, erzeugt es einen seitlichen Luftstrom, der das Flugzeug um die Hochachse dreht.
Primäre und sekundäre Wirkung von Querrudern
Die primäre Wirkung von Querrudern besteht darin, eine Rollbewegung um die Längsachse des Flugzeugs zu erzeugen. Wenn das Querruder nach unten bewegt wird, erhöht es auf seiner Seite den Auftrieb, wodurch sich diese Tragfläche hebt. Das andere Querruder bewegt sich nach oben, verringert somit den Auftrieb und die Tragfläche senkt sich. So entsteht eine Rollbewegung um die Längsachse.
Die sekundäre Wirkung des Querrudereinsatzes (auch negatives Rollmoment genannt) entsteht dadurch, dass das kurveninnere nach oben ausschlagende Querruder den Strömungswiderstand der abzusenkenden Tragfläche vermindert, das nach unten ausschlagende Querruder hingegen den Strömungswiderstand der anzuhebenden Tragfläche erhöht. Dadurch entsteht ein Drehmoment um die Hochachse des Flugzeugs, das als negatives Wendemoment bezeichnet wird.
Schaue dir dazu auch 5.4.4 Rollsteuerung an.
Um das negative Wendemoment etwas zu vermindern, ist es also nützlich, das Rollmoment mehr durch den negativen als durch den positiven Ruderausschlag zu erzeugen
→ differenzierte Querruder.
Unter Querruderdifferenzierung versteht man unterschiedlichen Ruderausschlag der beiden Querruder. Er ist beim nach unten (positiv) ausschlagenden Querruder kleiner als beim nach oben (negativ) ausschlagenden Ruder.

8.5.2 Nebensteueranlagen
Landehilfen
Da Segelflugzeuge von Haus aus niedrige Mindestfluggeschwindigkeiten haben, der Gleitwinkel jedoch sehr flach ist, wird mit Landehilfen in erster Linie eine Widerstandserhöhung bezweckt, während ihr Einfluss auf den Auftrieb eher im Hintergrund steht (bei Motorflugzeugen ist es umgekehrt). Darum wird beim Segelflugzeug und beim TMG als Oberbegriff die Luftbremse verwendet, die je nach Hersteller und Typ in verschiedene Landehilfenarten unterteilt ist.
Die verschiedenen, üblichen Möglichkeiten von Start- und Landehilfen sind:
Wölbklappen (Landeklappen) sind zwischen Rumpf und Querrudern angeordnet, wie Querruder aufgebaut (der hintere Teil des Tragflügels wird nach oben oder unten geklappt), bewegen sich aber gleichsinnig.
Die Bremsklappen sind ebenfalls über Gestänge, Führungen, Kniehebel und Schnellkupplungen mit dem blauen Bremsklappenhebel auf der linken Seite des Cockpits verbunden.
Um zu verhindern, dass die Klappen im Normalflug durch den Unterdruck an der Flügeloberseite "herausgesaugt" werden, werden sie durch einen Verriegelungsmechanismus in eingefahrener Position gehalten. Dieser Mechanismus verwendet Stangen und Hebel, die "überkniet" (überzentriert) sind, solange der Klappenhebel im Cockpit in der vorderen Position ist. Vergleiche den überstreckten Zustand mit dem "überknieten" Zustand des Knies, des Ellbogens oder des Kiefers. Wenn der Klappengriff nach hinten bewegt wird, wird zuerst die überstreckte Position beendet, danach können die Klappen geöffnet werden.
Spreizklappen ähneln Störklappen, sind aber auf der Flügelunterseite vor der Hinterkante angebracht, beeinflussen daher den Auftrieb nur geringfügig, erzeugen aber hohen Widerstand.
Hinterkantendrehklappen eines Mini Nimbus HS-7 (Wikipedia)
8.5.3 Vereisung
icing
Verschiedene Arten von Vereisung können im Flug vorkommen.
- Tragflächenvereisung
- Vergaservereisung
- Propellervereisung
- Haubenvereisung
TragflächenvereisungTragflächenvereisung ist ein Phänomen, bei dem sich Eis auf den Tragflächen eines Flugzeugs bildet. Dies kann zur Profilveränderung und dadurch einer Verschlechterung der Flugleistung und Flug-eigenschaften führen. Es gibt verschiedene Arten von Tragflächenvereisung
|
xx
Vergaservereisung
Die Vergaservereisung ist ein Phänomen, bei dem sich Eis im Ansaugkanal des Vergasers eines Benzinmotors ablagert. Dies kann die Funktion des Motors erheblich beeinträchtigen und ist besonders beim Betrieb von Flugzeugmotoren zu beachten.
Die Vergaservereisung entsteht durch die Abkühlung der angesaugten Luft im Venturirohr des Vergasers, wodurch sich in der Ansaugluft enthaltener Wasserdampf zu flüssigen Nebeltröpfchen kondensieren kann. Diese können bis unter den Gefrierpunkt unterkühlt werden und beim Berühren der Wandung des Ansaugkanals zu Eis erstarren.
Die Vergaservereisung macht sich bei Verstellluftschraube durch Abfall des Ladedrucks bemerkbar und bei starrer Luftschraube durch Abfall der Motordrehzahl.
Propellervereisung
|
Bei ungleichem Eisansatz entsteht Unwucht, die zu starken Schäden führen kann. Merkst du ungewohnte Vibrationen, kannst du versuchen durch ruckartige Drehzahländerungen das Eis zu entfernen, ansonsten reduzierst du die Drehzahl, damit ggf. die Vibrationen aufhören. Geschieht das nicht, solltest du das Triebwerk abstellen und landen. |
 |
Haubenvereisung
Eis auf der Innenseite der Cockpithaube kann durch eine Kombination aus Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen entstehen. Wenn die Luftfeuchtigkeit im Cockpit hoch ist und die Temperatur niedrig ist, kann sich Feuchtigkeit auf der Innenseite der Cockpithaube absetzen und gefrieren.
Um Eisbildung auf der Innenseite der Cockpithaube zu verhindern, gibt es verschiedene Methoden. Eine Möglichkeit besteht darin, die Luftfeuchtigkeit im Cockpit zu reduzieren, indem man das Fenster öffnet, oder absteigt in niedrigere Höhen, um die Temperatur im Cockpit wieder zu erhöhen, um so das Risiko von Eisbildung zu verringern.
Anmerkung:
Über die Vereisungsgefahr wirst du immer mal wieder hören und du stellst dir evtl. die Frage, ob das überhaupt für dich oder gar den Segelflug zutrifft.
Die einfache Antwort ist "JA". Spätestens wenn du nach dem Thermik- oder Wellenfliegen mit einem unterkühlten Flugzeug absteigst, musst du ggf. auf Vereisung gefasst sein.
Vergaservereisung ist nicht selten, daher haben auch viele TMG eine zusätzliche Vergaservorwärmung und eine vereiste Haube kommt öfters vor, als du denkst.
Siehe hierzu auch die fsm 2-81 Vereisung und das AOPA Safty Letter "Vereisung"